Àlex Rovira und Francesc Miralles: Einsteins Versprechen
 Dieses Buch direkt bei Amazon bestellen!
Dieses Buch direkt bei Amazon bestellen!
Lieber Leser, Sie sehen mich weinen. Warum? Ich habe soeben das Buch „Einsteins Versprechen“ zu Ende gelesen und habe – und das ist keine literarische Übertreibung – Tränen in den Augen. Vor Wut. Da habe ich mich einige Nachmittage lang durch das langweiligste spannende Buch gekämpft, das mir je untergekommen ist, und stehe nun vor der banalsten falsch-wahren Weisheit, die je verkündet wurde. Verwirrt Sie das? Ja? Mich auch.
Also was ist passiert? Ich habe ein Buch gelesen, das damit anfängt, dass ein spanischer Wissenschaftsjournalist namens Javier aus der Not heraus öffentlich spontan vermutet, Albert Einstein habe in seinen letzten Jahren offenbar etwas ganz Großes entdeckt, das so „potent“ ist, dass er es der damals noch nicht reifen Menschheit noch nicht offenbaren wollte. Kurz darauf sieht sich Javier in eine mysteriöse Suche nach dieser Erkenntnis hineingezogen. Diese Suche basiert auf der Idee, dass Einstein seiner unehelichen und von ihm lange ignorierten Tochter diese Erkenntnis zugespielt hat, sie ihr sozusagen „vererbte“. Jene Lieserl habe dann, so die Idee, dieses Erbe ihrer Tochter vermacht. Man müsse also jene Einstein-Enkelin finden, lautet die Arbeitsthese der Suchenden.
Wobei „Suche“ ein fast schon euphemistischer Ausdruck ist, zumindest was Ich-Erzähler Javier angeht. Der Journalist wirkt eher wie ein im Wind aus Zeichen, Andeutungen und Hinweisen getriebenes halbtotes Blatt. Sarah, mit der er gemeinsam unterwegs ist, scheint da schon gezielter vorzugehen, obwohl auch das eher eine Vermutung als eine im Buch erkennbare Tatsache ist. Die anderen Suchenden überleben übrigens das Buchende nicht, nach und nach werden sie von diesem oder jenem eliminiert. Einer der „Mörder“ ist eine junge Frau, die – wie auch immer sie das schafft – offenbar besser als alle anderen sichtbaren und (anfangs) unsichtbaren Figuren weiß, was gerade vorgeht.
Das für mich unverständlicher Weise mit einem Literaturpreis geehrte Buch (laut Klappentext: der hochdotierte „Premio de Novela Ciudad de Torrevieja“) wird in einer Sprache erzählt, die extrem leicht lesbar weil extrem simpel gehalten ist. Spaß am Text lag eindeutig nicht in der Intension der Autoren. Àlex Rovira und Francesc Miralles setzen statt dessen auf einen der neumodischen Verschwörungs-und-Quest-Plots. Nicht, dass ihnen das gut gelingen würde, die Figuren nähern sich zwar faktisch und lokal ihrem Ziel, der Einstein-Erbin, das eigentliche Geheimnis bleibt aber trotz diverser Annäherungsversuche so fern wie am Anfang. In dieser Sache passiert nichts – bis zu jenem unsäglichen Finale, das mich so erbost und verzweifeln lässt.
Wenn ich sage, es passiert nichts, dann bezieht sich das auch auf die Figuren. Sie sind das, was ich als Lektor meinen Kunden gegenüber als Marionetten bezeichne. Dass Javier offenbar nicht den geringsten Nerv dafür hat, in seinen Mitmenschen Emotionen und Stimmungen zu erkennen und seine Beschreibungen sich auf rein Plakatives beschränken, mag ja noch entschuldbar sein, aber er selbst ist innerlich – vorsichtig ausgedrückt – auch eher tot als lebendig. Ihn wandelt immer mal ein wenig Trauer an, wenn er an seine zerbrochene Ehe zurückdenkt, und er versucht dem Zuhörer weis zu machen, er habe sich in Sarah verliebt. So wie das erste pure Behauptung bleibt, kann man auch das zweite zwar zur Kenntnis nehmen, aber sehen, nachfühlen kann man es nicht. Dass auf Javiers Empfindungen bei Mord und Totschlag und sogar bei den (angeblich) spektakulären Enthüllungen am Ende der Begriff „blass“ noch eine maßlose Übertreibung ist, passt da prima ins Bild.
Und genau das macht das Buch langweilig. Zwar erlaubt der kunstlose Schreibstil, dass man der Frage „Was hat Genie Einstein wohl herausgefunden?“ ohne Anstrengung hinterlaufen kann, aber auf dieser Rennstrecke gibt es nichts zu entdecken. Die Figuren sind uninteressant, der Ablauf der Suche nicht aufregend, weil sich nie akute Spannung aufbaut. Statt mit Spannungsbögen arbeiten die Autoren mit Sätzen wie „Hätte ich geahnt, auf was für einem Spielfeld ich mich bewegte, hätte ich niemals auf ,Senden‘ geklickt.“ oder „Hätte ich jedoch den Namen Sarah Brunet rechtzeitig überprüft, wäre alles, was in Kürze geschehen sollte, vollkommen anders verlaufen.“ Das ist Spannungsbildung für Möchtegern-Schriftsteller. Magisch, wie der Klappentext auf dem Buch behauptet, ist da gar nichts.
Bevor ich zum Hauptdesaster dieses Werkes komme, will ich mal einen kleinen Ausflug in die Abteilung „Gut am Buch“ machen. Groß ist die allerdings ohnehin nicht. Die anspruchslose Sprache in den vielen superkurzen Kapiteln zum Beispiel zählt in dem Sinne dazu, dass sie das Lesen nicht zusätzlich erschwert, und wer noch nicht viel über Einsteins Leben wusste, kann es anhand der biografischen Einschübe ein wenig kennenlernen.
Als günstig erwies sich auch, dass man über Physik generell und die Einstein’sche im Besonderen gar nichts wissen muss, um dem Buch folgen zu können. Denn auch wenn ständig so getan wird, als habe das zu lüftende Geheimnis eine vergleichbare Bedeutung wie die zur Atombombe geführt habende Gleichung E = mc2: Die „Enthüllung“ ist eher simpelste Kindergarten-Philosophie. Dazu hätte weder Einstein bemüht, noch ein mit Toten gepflasterter Weg beschritten werden müssen. Dafür ist weder die Weltreise der Figuren nötig gewesen noch das am Ende dahingesagte Existieren von zwei rivalisierenden Organisationen (die ganz bestimmt als Methaper für dies und jenes gemeint sind, wie so manch anderes in dem Buch). Denn – bitte halten Sie sich fest! – die letzte große Erkenntnis Einsteins ist nicht der Grundstein für eine Superbombe oder die Lösung aller Energieprobleme der Menschheit, keine Erkenntnis darüber, dass wir alle nicht real sind, dass wir allein sind im All oder auch nicht allein sind. Nein, es viel ungeheuerlicher. Einsteins letzte Erkenntnis ist die von der Über-Kraft, die alle anderen Kräfte in sich vereint und damit die von den Wissenschaftlern seit jeher gesuchte Einheitliche Theorie des Universums möglich macht. Es ist – Trara! – die Liebe.
Tja. Was soll man da noch sagen …
Àlex Rovira und Francesc Miralles
Einsteins Versprechen
384 Seiten, gebunden
List
ISBN-10: 3471350519
ISBN-13: 978-3471350515
-> Dieses Buch jetzt bei Amazon bestellen
 Dieses Buch direkt bei Amazon bestellen!
Dieses Buch direkt bei Amazon bestellen!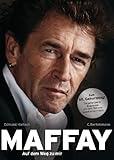 Dieses Buch direkt bei Amazon bestellen!
Dieses Buch direkt bei Amazon bestellen!





