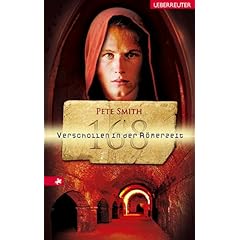Roger Tabor: Die Sprache der Katzen
 Katzen haben ihre Eigenheiten, das wird jeder Katzenhalten bestätigen. Warum die Katze ist, wie sie ist, erklärt Roger Tabor in seinem Buch genau. Er weiß, warum so viele Menschen Katzen halten, warum sie von den Stubentigern so fasziniert sind.
Katzen haben ihre Eigenheiten, das wird jeder Katzenhalten bestätigen. Warum die Katze ist, wie sie ist, erklärt Roger Tabor in seinem Buch genau. Er weiß, warum so viele Menschen Katzen halten, warum sie von den Stubentigern so fasziniert sind.
Zunächst geht es um den Körperbau der Katze, der es ihr ermöglicht, sich so perfekt fortzubewegen, zu springen und die Balance zu halten. Der Autor erklärt wie die Katze sieht und was sie mit ihren Tasthaaren spüren kann, wie sie hört, schmeckt und riecht. Auch das Jacobsonsche Organ, mit dem die Katze Gerüche „schmecken“ kann, ist Thema. Interessant sind auch die Ausführungen über Zähne, Pfoten und Krallen der Katze.
Der Autor hat sich viel mit Katzen beschäftigt und sie beobachtet. So ist er auch der Frage nachgegangen, ob Katzen einen Verstand haben. Es wird genau analysiert, wie das Gehirn der Tiere funktioniert, was angeborenes oder erlerntes Verhalten ist. Roger Tabor zeigt, wie erwachsene Tiere miteinander spielen oder raufen, was sie mit ihrer Mimik ausdrücken und mit ihrer Katzensprache vermitteln und was das Schnurren zu bedeuten hat.
Spannend ist es zu erfahren, wie Katzen sich verhalten, wie sie ihr Territorium markieren. Der Auto erzählt, wie eine Katze jagt, aber auch wie sie schläft oder sich putzt. Auch wie Katzenfamilien leben, erfährt der Leser. Von der Partnersuche bis zur Geburt der kleinen Kätzchen. Weiter geht es mit der Entwicklung der Katzbabys bis zur Entwöhnung von der Mutter.
Für zukünftige Katzenhalter wird das Kapitel „Katzen halten“ interessant sein. Hier werden Rassekatzen vorgestellt, aber auch ungünstige Zuchtformen erwähnt. Der Leser erfährt alles über Futterzeiten, Fellpflege bis hin zur Erziehung. Auch für Halter mehrerer Katzen gibt es viele Ratschläge. Auch Probleme, die mit Katzen im Haus auftreten können, werden besprochen.
Nach der Lektüre des Buches werden Katzenhalter ihr Tier viel besser verstehen. Die Katze wird vom Autor aus vielen Blickwinkeln betrachtet, der bei seinen Erklärungen ins Detail geht. Besonders den Dingen im Verhalten der Katze, welchen Menschen gern mit Unverständnis begegnen, werden unter die Lupe genommen. Über manches kann man nur staunen. Selbst wer meint, seine Katze ganz genau zu kennen, wird viel Neues erfahren.
In den Texten spürt man die Leidenschaft des Autors für die beliebten Stubentiger. Seine Faszination überträgt sich auch auf den Leser. Davon abgesehen ist das Buch sehr kurzweilig geschrieben.
Auch die Fotos, fast alle vom Autor selbst, sind etwas ganz Besonderes. Man kann sich kaum vorstellen, welche Geduld er aufgebracht haben muss, um zu solchen außergewöhnlichen Fotos zu kommen. So sieht man die Katze mitten im Sprung, halsbrecherisch balancierend auf einem Baum beim Überklettern eines Maschendrahtzaunes, auf der Jagd beim Anschleichen, bei einer Rauferei usw. Das Verhalten der Katzen wird also immer auch mit vielen Bildern dokumentiert.
Fazit: „Die Sprache der Katzen“ ist ein beeindruckendes, faszinierendes und vor allem einzigartiges Buch, das jeder Katzenfreund unbedingt lesen sollte!
Über den Autor:
Der Biologe Roger Tabor zählt weltweit zu den führenden Katzenexperten. Er hat zahlreiche Feldforschungen über verwilderte Katzen und Hauskatzen durchgeführt, aber auch eine ganze Reihe Bücher veröffentlicht, sowie die BBC-Fernsehprogramme „Cats“ und „Understanding Cats“ präsentiert.
Rezension von Heike Rau
Roger Tabor
Die Sprache der Katzen
Mimik, Laute, Körpersignale
Aus dem Englischen von Claudia Ade
144 Seiten, gebunden, 250 Farbfotos
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
ISBN-10: 3-8001-4927-3
ISBN-13: 978-3-8001-4927-8
Bestellen